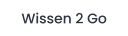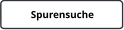Erich Kästner - Emil und die Detektive
oder
Die Kinderliteratur-Revolution aus Berlin

Was wären, um nur einige zu nennen, Astrid Lindgren, Enid Blyton, „Alfred Hitchcocks“ Die drei Fragezeichen und alle nicht
genannten, ohne Erich Kästner und sein Buch Emil und die Detektive?
Emil und die Detektive gilt in der Literaturgeschichte als das erste moderne Kinderbuch, sogar als Revolution der Kinderliteratur,
da u.a. erstmals in einem Kinderbuch Kindern Subjektstatus zuerkannt wurde.
Neu war auch, dass hier die soziale Wirklichkeit in einem Kinderbuch dargestellt wird, der Roman in einer realistisch
beschriebenen Großstadt spielt und dass er in einer kindgerechten Sprache geschrieben ist, mit vielen umgangssprachlichen
Wendungen in den Dialogen (und nicht, bis dato üblich, in einer erzieherischen Hochsprache).
In dem Buch werden Humor, Abenteuer und Milieuschilderung von Kästner bunt gemischt. Der neuartige Ton der Geschichte
regte die Kinderliteratur an. Zuvor waren Bücher für Kinder fast durchgehend märchenhaft oder moralisierend oder beides
zugleich.
Aber auch die Verschmelzung von „Fiktion und Wirklichkeit“ wird hier von Kästner mit eingearbeitet.
Und wo wurde dieses literarische Meisterwerk geschrieben? Genau! In Berlin!
In dem Jahr (1928), in dem Kästner dieses Buch schrieb, wohnte er in einem möblierten Zimmer »in Logis« bei der Witwe
Ratkowski in der Prager Str. 17.
Sein „literarisches Büro“ aber, wo er sein Buch Emil und die Detektive schrieb, befand sich ca. 300 m von seiner Wohnung entfernt,
das Café „Josty“. Eine Filiale des Stamm Cafés „Josty“ am Potsdamer Platz.
Das »Josty« war 1928 bereits eine über 115 jährige Berliner Legende. Schon Heinrich Heine, die Gebrüder Grimm und Theodor
Fontane pilgerten zu Kaisers Zeiten dorthin für Kaffee und Kuchen.
Cafés der Metropolen waren nämlich seinerzeit gleichzeitig Wärmestuben, Kontaktbörsen und Redaktionsräume für Kreative aller
Art.
Aber warum nun dieser, vielleicht, uninteressante Ausflug zum Café „Josty“?
Die in Knallgelb gehaltene Illustration des Zeichners Walter Trier zeigt zwei Jungs hinter einer schmalen Litfaßsäule, die einen
Mann mit steifem Hut beobachten. Das stilisierte Eckgebäude im Hintergrund besteht aus einem Ladenlokal mit großen Fenstern
und einer von einem gestreiften Baldachin geschützten Außenterrasse.
Das Café Josty.
Das Buch erschien im Herbst 1929 im Kinderbuchverlag Williams & Co und wurde ein Riesenerfolg. Bis heute
wurde es in 54 Sprachen übersetzt, acht Mal verfilmt, ungezählte Male auf Theater- und Musicalbühnen
aufgeführt, in verschiedene Brettspiele übersetzt und im Radio gesendet. Schon kurz nach der Veröffentlichung
konnte sich Kästner eine eigene Wohnung in der Roscherstraße 16 im Stadtteil Charlottenburg leisten.
Zusätzliche Informationen:
1. Prager Str. 17 (heute Prager Str. 10 – an der Stelle des ehemaligen Wohnhauses steht heute der Erich Kästner
Kindergarten).
- das Café Josty lag an der damaligen Kaiserallee 201 (heute Bundesallee), Ecke Trautenaustraße.
2. Kästner, der selbst mit erstem Vornamen Emil hieß, ließ sich bei den Figuren Emils und seiner Mutter von seiner
Biographie inspirieren und taucht auch selbst in der Handlung auf – in seinem realen Beruf als Zeitungsjournalist.
In der Geschichte griff Kästner auf ein Erlebnis aus seiner Kindheit in Dresden zurück: Dort verfolgte und stellte er
eine Betrügerin, die seine Mutter, eine Friseurin, geschädigt hatte.
3. Als »Emil und die Detektive« 1931 verfilmt wurde, spielte Kästner in einem Cameo-Auftritt (häufig überraschende, zeitlich sehr
kurze Auftreten einer bekannten Person in einem Film, einer Serie) einen Straßenbahn-Passagier, der Emil die Fahrkarte bis zum
»Café Josty« spendiert. Die Dreharbeiten fanden größtenteils an Originalschauplätzen statt. So zeigt der Film heute noch etwas von
dem Flair, das 14 Jahre später in Schutt und Asche liegen sollte.
4. Der erfolgreiche Kinderbuchverlag Williams & Co gehörte der Verlegerin Edith Jacobsohn.
Sie führte den Verlag gemeinsam mit ihrem Ehemann Siegfried Jacobsohn, dem Herausgeber der Wochenzeitschrift „Die
Weltbühne“.
1933 musste Edith Jacobsohn über Wien und die Schweiz nach England emigrieren. Sie überließ die Geschäftsführung ihrer
Mitarbeiterin Cecilie Dressler.
Im selben Jahr kaufte Kurt Leo Maschler, damals schon Inhaber mehrerer Verlage, den Verlag Williams & Co. Zwei Jahre später
gründete er zusätzlich in Basel den Atrium Verlag, damit Erich Kästner, dessen Texte inzwischen in Deutschland verboten waren,
seine Bücher weiterhin veröffentlichen konnte. Fast alle Rechte des Williams-Verlags übertrug Maschler, um sie vor den
Nationalsozialisten zu schützen, an den Atrium-Verlag in der Schweiz.
Cecile Dressler erwarb 1936 von Maschler Anteile am Verlag, der jetzt für einige Jahre unter der Bezeichnung Williams-Verlag,
Inhaberin Cecilie Dressler firmierte. 1941 erfolgte eine Umbenennung in Cecilie Dressler Verlag. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
Cecilie Dressler Eigentümerin des Verlages, der 1971 von der Verlagsgruppe Friedrich Oetinger übernommen wurde.
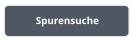
Interaktiver Stadtplan
Spurensuche Emil und die Detektive in Berlin.
Über diesen interaktiven Stadtplan bei Google Maps
können Sie die im Buch beschriebenen Orte in Berlin
besuchen.
Smartphone-User bitte, wegen voller Leistung,
den Button „Speichern“ klicken.


Empfehlenwertes Buch
Kästners Berlin
Literarische Schauplätze
von Michael Bienert
Gebundene Ausgabe
Verlag für Berlin-Brandenburg
160 Seiten
ISBN 978-3-945256-00-8
Erich Kästner - Emil und die Detektive
oder
Die Kinderliteratur-Revolution aus Berlin

Was wären, um nur einige zu nennen,
Astrid Lindgren, Enid Blyton, „Alfred
Hitchcocks“ Die drei Fragezeichen und
alle nicht genannten, ohne Erich
Kästner und sein Buch Emil und die
Detektive?
Emil und die Detektive gilt in der
Literaturgeschichte als das erste
moderne Kinderbuch, sogar als
Revolution der Kinderliteratur, da u.a.
erstmals in einem Kinderbuch Kindern
Subjektstatus zuerkannt wurde.
Neu war auch, dass hier die soziale
Wirklichkeit in einem Kinderbuch
dargestellt wird, der Roman in einer
realistisch beschriebenen Großstadt
spielt und dass er in einer
kindgerechten Sprache geschrieben
ist, mit vielen umgangssprachlichen Wendungen in den Dialogen (und nicht,
bis dato üblich, in einer erzieherischen Hochsprache).
In dem Buch werden Humor, Abenteuer und Milieuschilderung von Kästner
bunt gemischt. Der neuartige Ton der Geschichte regte die Kinderliteratur an.
Zuvor waren Bücher für Kinder fast durchgehend märchenhaft oder
moralisierend oder beides zugleich.
Aber auch die Verschmelzung von „Fiktion und Wirklichkeit“ wird hier von
Kästner mit eingearbeitet.
Und wo wurde dieses literarische Meisterwerk geschrieben? Genau! In Berlin!
In dem Jahr (1928), in dem Kästner dieses Buch schrieb, wohnte er in einem
möblierten Zimmer »in Logis« bei der Witwe Ratkowski in der Prager Str. 17.
Sein „literarisches Büro“ aber, wo er sein Buch Emil und die Detektive schrieb,
befand sich ca. 300 m von seiner Wohnung entfernt, das Café „Josty“. Eine
Filiale des Stamm Cafés „Josty“ am
Potsdamer Platz.
Das »Josty« war 1928 bereits eine
über 115 jährige Berliner Legende.
Schon Heinrich Heine, die Gebrüder
Grimm und Theodor Fontane
pilgerten zu Kaisers Zeiten dorthin
für Kaffee und Kuchen.
Cafés der Metropolen waren
nämlich seinerzeit gleichzeitig
Wärmestuben, Kontaktbörsen und Redaktionsräume für Kreative aller Art.
Aber warum nun dieser, vielleicht, uninteressante Ausflug zum Café „Josty“?
Die in Knallgelb gehaltene Illustration des Zeichners Walter Trier zeigt zwei
Jungs hinter einer schmalen Litfaßsäule, die einen Mann mit steifem Hut
beobachten. Das stilisierte Eckgebäude im Hintergrund besteht aus einem
Ladenlokal mit großen Fenstern und einer von einem gestreiften Baldachin
geschützten Außenterrasse.
Das Café Josty.
Das Buch erschien im Herbst 1929 im Kinderbuchverlag Williams & Co und
wurde ein Riesenerfolg. Bis heute wurde es in 54 Sprachen übersetzt, acht Mal
verfilmt, ungezählte Male auf Theater- und Musicalbühnen aufgeführt, in
verschiedene Brettspiele übersetzt und im Radio gesendet. Schon kurz nach
der Veröffentlichung konnte sich Kästner eine eigene Wohnung in der
Roscherstraße 16 im Stadtteil Charlottenburg leisten.
Zusätzliche Informationen:
1. Prager Str. 17 (heute Prager Str. 10 – an der Stelle des ehemaligen
Wohnhauses steht heute der Erich Kästner Kindergarten).
- das Café Josty lag an der damaligen Kaiserallee 201 (heute Bundesallee),
Ecke Trautenaustraße.
2. Kästner, der selbst mit erstem Vornamen Emil hieß, ließ sich bei den Figuren
Emils und seiner Mutter von seiner Biographie inspirieren und taucht auch
selbst in der Handlung auf – in seinem realen Beruf als Zeitungsjournalist. In
der Geschichte griff Kästner auf ein Erlebnis aus seiner Kindheit in Dresden
zurück: Dort verfolgte und stellte er eine Betrügerin, die seine Mutter, eine
Friseurin, geschädigt hatte.
3. Als »Emil und die Detektive« 1931 verfilmt
wurde, spielte Kästner in einem Cameo-
Auftritt (häufig überraschende, zeitlich sehr
kurze Auftreten einer bekannten Person in
einem Film, einer Serie) einen Straßenbahn-
Passagier, der Emil die Fahrkarte bis zum
»Café Josty« spendiert. Die Dreharbeiten
fanden größtenteils an Originalschauplätzen
statt. So zeigt der Film heute noch etwas von
dem Flair, das 14 Jahre später in Schutt und
Asche liegen sollte.
4. Der erfolgreiche Kinderbuchverlag
Williams & Co gehörte der Verlegerin Edith
Jacobsohn.
Sie führte den Verlag gemeinsam mit ihrem Ehemann Siegfried Jacobsohn,
dem Herausgeber der Wochenzeitschrift „Die Weltbühne“.
1933 musste Edith Jacobsohn über Wien und die Schweiz nach England
emigrieren. Sie überließ die Geschäftsführung ihrer Mitarbeiterin Cecilie
Dressler.
Im selben Jahr kaufte Kurt Leo Maschler, damals schon Inhaber mehrerer
Verlage, den Verlag Williams & Co. Zwei Jahre später gründete er zusätzlich in
Basel den Atrium Verlag, damit Erich Kästner, dessen Texte inzwischen in
Deutschland verboten waren, seine Bücher weiterhin veröffentlichen konnte.
Fast alle Rechte des Williams-Verlags übertrug Maschler, um sie vor den
Nationalsozialisten zu schützen, an den Atrium-Verlag in der Schweiz.
Cecile Dressler erwarb 1936 von Maschler Anteile am Verlag, der jetzt für
einige Jahre unter der Bezeichnung Williams-Verlag, Inhaberin Cecilie Dressler
firmierte. 1941 erfolgte eine Umbenennung in Cecilie Dressler Verlag. Nach
dem Zweiten Weltkrieg wurde Cecilie Dressler Eigentümerin des Verlages, der
1971 von der Verlagsgruppe Friedrich Oetinger übernommen wurde.

Interaktiver Stadtplan
Spurensuche Emil und die Detektive in Berlin.
Über diesen interaktiven Stadtplan bei Google Maps
können Sie die im Buch beschriebenen Orte in Berlin
besuchen.
Smartphone-User bitte, wegen voller Leistung,
den Button „Speichern“ klicken.


Empfehlenwertes Buch
Kästners Berlin
Literarische Schauplätze
von Michael Bienert
Gebundene Ausgabe
Verlag für Berlin-Brandenburg
160 Seiten
ISBN 978-3-945256-00-8